Analysis
Aufgabe 1A
Um Regenwasser zu speichern, wird es kontrolliert in ein unterirdisches Auffangbecken geleitet, das ein Fassungsvermögen von hat. Für ein bestimmtes Regenereignis wird das Volumen des Regenwassers im Auffangbecken für
modellhaft durch die in
definierte Funktion
mit
beschrieben.
Dabei ist die seit Beobachtungsbeginn vergangene Zeit in Stunden
und
das Wasservolumen in Kubikmetern
Begründe, dass zu Beobachtungsbeginn das Wasservolumen im Auffangbecken beträgt, und berechne das Volumen des Wassers, das in den ersten
nach Beobachtungsbeginn in das Auffangbecken fließt.
Betrachtet wird außerdem die in definierte Funktion
mit
Zeige, dass die momentane Änderungsrate des Volumens des Wassers im Auffangbecken in für den betrachteten Zeitraum durch
beschrieben werden kann.
Weise anhand des gegebenen Terms von nach, dass für den durch
beschriebenen Zeitraum das Volumen des Wassers im Auffangbecken zu keinem Zeitpunkt abnimmt.
Es wird geplant, zwei Stunden nach Beobachtungsbeginn eine Pumpe einzuschalten, die Wasser aus dem Auffangbecken mit einer konstanten Rate von abpumpt. Die momentane Zuflussrate des Regenwassers in das Auffangbecken wird dabei weiterhin durch
beschrieben.
Die folgende Gleichung hat im Sachzusammenhang eine Lösung
Gib die Bedeutung von im Sachzusammenhang an und erläutere den Aufbau der Gleichung in Bezug auf diese Bedeutung.
Gegeben sind die in definierte Funktion
mit
und die Stelle
Es gilt:
Weise nach, dass eine Wendestelle von
ist.
Es gibt im ersten Quadranten ein Flächenstück, das von der -Achse, dem Graphen von
und der Gerade parallel zur
-Achse, die durch den Wendepunkt
verläuft, eingeschlossen wird.
Berechne den Inhalt dieses Flächenstücks.
Die Abbildung 1 zeigt den Graphen von
Die Punkte und
sind für jeden Wert von
mit
die Eckpunkte eines symmetrischen Trapezes.
Skizziere das symmetrische Trapez für in der Abbildung 1.
Ermittle einen Term, der den Flächeninhalt des symmetrischen Trapezes in Abhängigkeit von angibt.
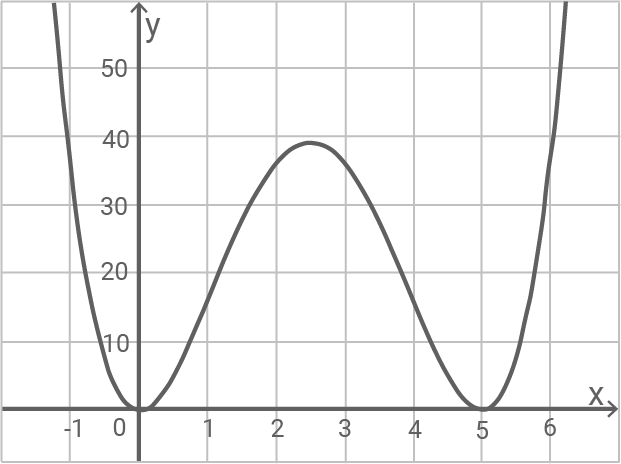
Aufgabe 1B
Gegeben ist die in definierte Funktion
mit
Gib die Koordinaten des Schnittpunkts des Graphen von mit der
-Achse sowie das Verhalten von
für
und
an.
Im Folgenden wird die Lösung zu einer Aufgabenstellung in Bezug auf den Graphen von dargestellt:
Gib die sich daraus ergebenden Eigenschaften des Graphen von im Punkt
an.
Der Graph von schließt mit den beiden Koordinatenachsen eine Fläche ein. Die Fläche soll durch eine Gerade, die parallel zur
-Achse verläuft, in zwei gleich große Teilflächen zerlegt werden.
Bestimme eine Gleichung dieser Gerade.
Ein Mobilfunkanbieter betreibt eine Hotline, die an jedem Tag Stunden erreichbar ist. Die Wartezeit eines Anrufers dieser Hotline ist abhängig vom Zeitpunkt des Anrufs. Durch die in
definierte Funktion
mit
kann die Wartezeit an einem bestimmten Tag für die Zeitpunkte von
Uhr bis einschließlich
Uhr beschrieben werden. Dabei bezeichnet
den Zeitpunkt des Anrufs in Stunden nach
Uhr und
die Wartezeit in Sekunden. Nimmt
beispielsweise an der Stelle
den Wert von etwa
an, so beträgt die Wartezeit für einen Anruf um
Uhr etwa
Sekunden.
Berechne die Wartezeit für einen Anruf um Uhr.
Ein anderer Anruf erfolgt später als Uhr und hat eine Wartezeit von
Sekunden.
Bestimme die Uhrzeit dieses Anrufs auf eine Minute genau.
Ermittle rechnerisch für den Zeitraum von Uhr bis einschließlich
Uhr den Zeitpunkt eines Anrufs, zu dem die Wartezeit am längsten ist, und den Zeitpunkt eines Anrufs, zu dem die Wartezeit am kürzesten ist.
Die Abbildung zeigt den Graphen von für
Für reelle Zahlen und
mit
gilt:
Wenn ist, so beträgt die durchschnittliche Wartezeit für Anrufe zwischen den durch
und
gegebenen Zeitpunkten
Sekunden.
Bestimme durch geeignete Eintragungen in der Abbildung jeweils einen möglichen Wert für und
, sodass zwischen den zugehörigen Zeitpunkten die durchschnittliche Wartezeit
Sekunden beträgt.
Beschreibe dein Vorgehen.
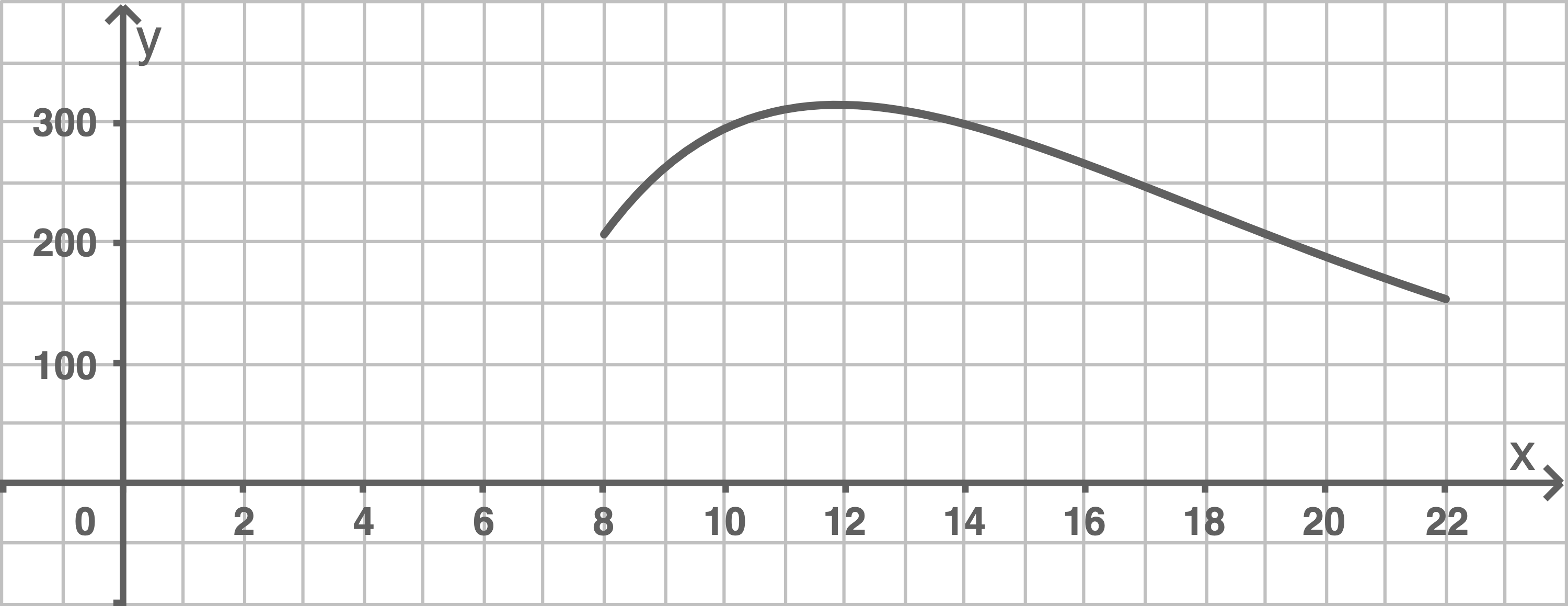
Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!
monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung 1A
Volumen zum Zeitpunkt berechnen
Volumen des Wassers in den ersten Stunden berechnen
Es fließen etwa Wasser in das Auffangbecken.
Im Intervall sind sowohl
als auch
stets positiv. Daher ist auch
immer positiv. Das bedeutet, dass
in diesem Bereich streng monoton steigt - das Wasservolumen also zu keinem Zeitpunkt abnimmt.
Zu Beginn der Pumpentätigkeit befindet sich ein Wasservolumen von im Becken. Dieses Anfangsvolumen wird durch die ersten beiden Summanden erfasst. Die Funktion
beschreibt, wie schnell sich das Wasservolumen unter dem Einfluss der laufenden Pumpe verändert - angegeben in Kubikmetern pro Stunde.
Der Term gibt den Zuwachs oder Verlust an Wasser im Zeitraum ab dem Einschalten der Pumpe (ab
) bis zum gewählten Zeitpunkt
an.
Berechnung der zweiten und dritten Ableitung von mithilfe des GTR
Berechnung der notwendigen Bedingung
Berechnung der hinreichenden Bedingung
Da beide Bedingungen erfüllt sind, ist die Stelle eine Wendestelle von
Die Fläche wird von der Geraden, die durch den Wendepunkt verläuft, und vom Graphen der Funktion
eingeschlossen. Somit muss die Fläche unter
von der Fläche unter der Geraden im Intervall
abgezogen werden.
Durch Ausrechnen mit dem GTR folgt:
Das symmetrische Trapez einzeichnen
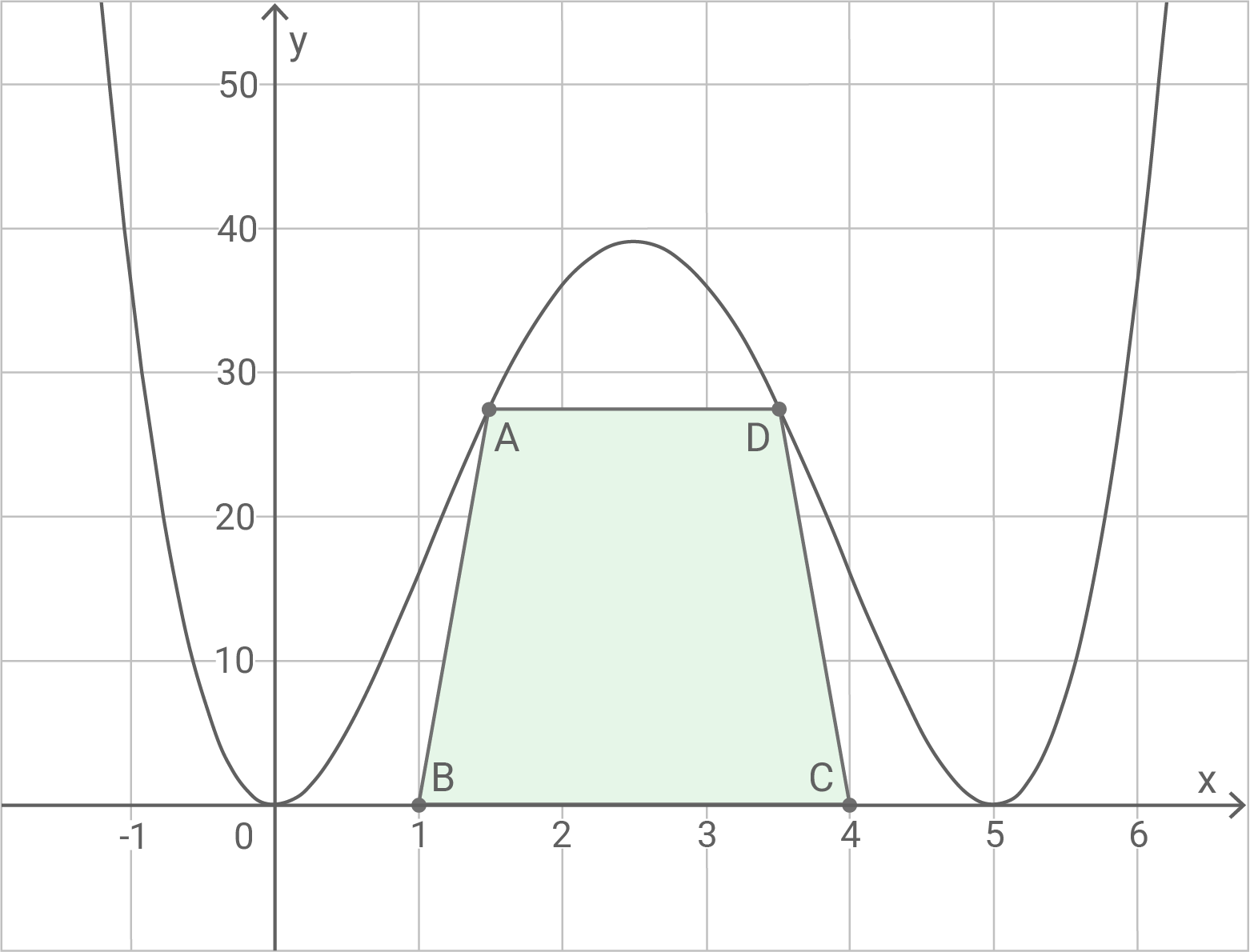
Term, der den Flächeninhalt angibt, bestimmen
Da die -Koordinaten identisch sind, reicht es aus, den Abstand zwischen den
-Koordinaten zu berechnen.
Länge der Strecke berechnen
Länge der Strecke berechnen
Die Höhe des Trapezes ergibt sich aus dem Funktionswert an der Stelle , also
. Die beiden parallelen Seiten des Trapezes haben die Längen 3 (für
) und
(für
). Daraus folgt für den Flächeninhalt des Trapezes die Formel:
Lösung 1B
Koordinaten des Schnittpunktes mit der -Achse bestimmen
Mit der graphischen Darstellung des GTR folgt:
Verhalten gegen Unendlich bestimmen
Der Graph von hat im Punkt
wegen der notwendigen Bedingung
und wegen der hinreichenden Bedingung
einen Wendepunkt und wegen
eine negative Steigung.
Da bei
eine Nullstelle hat, liegt die betrachtete Fläche im Intervall
Gesucht ist eine Gerade parallel zur -Achse, die diese Fläche in zwei gleich große Teilflächen teilt. Das bedeutet: Gesucht ist ein Wert
, für den gilt:
Auflösen mit dem GTR nach liefert die Lösung
Damit ist
eine Gleichung der Gerade.
Wartezeit um Uhr berechnen
Die Wartezeit beträgt etwa Sekunden.
Uhrzeit des Anrufs bestimmen
liefert
Der gesuchte Zeitpunkt ist etwa Uhr
Die längste Wartezeit ist beim lokalen Maximum der Funktion
Die kürzeste Wartezeit ist entweder um Uhr oder um
Uhr.
Ableiten von mit dem GTR liefert:
Nullsetzen der Ableitung mithilfe des GTR liefert als Maximum des Graphen:
Einsetzen von in
liefert für den Funktionswert:
Durch systematisches Ausprobieren folgt für das Minimum des Graphen:
Uhrzeit zum Zeitpunkt der längsten Wartezeit berechnen
Somit ist die längste Wartezeit um etwa Uhr und die kürzeste Wartezeit um
Uhr.
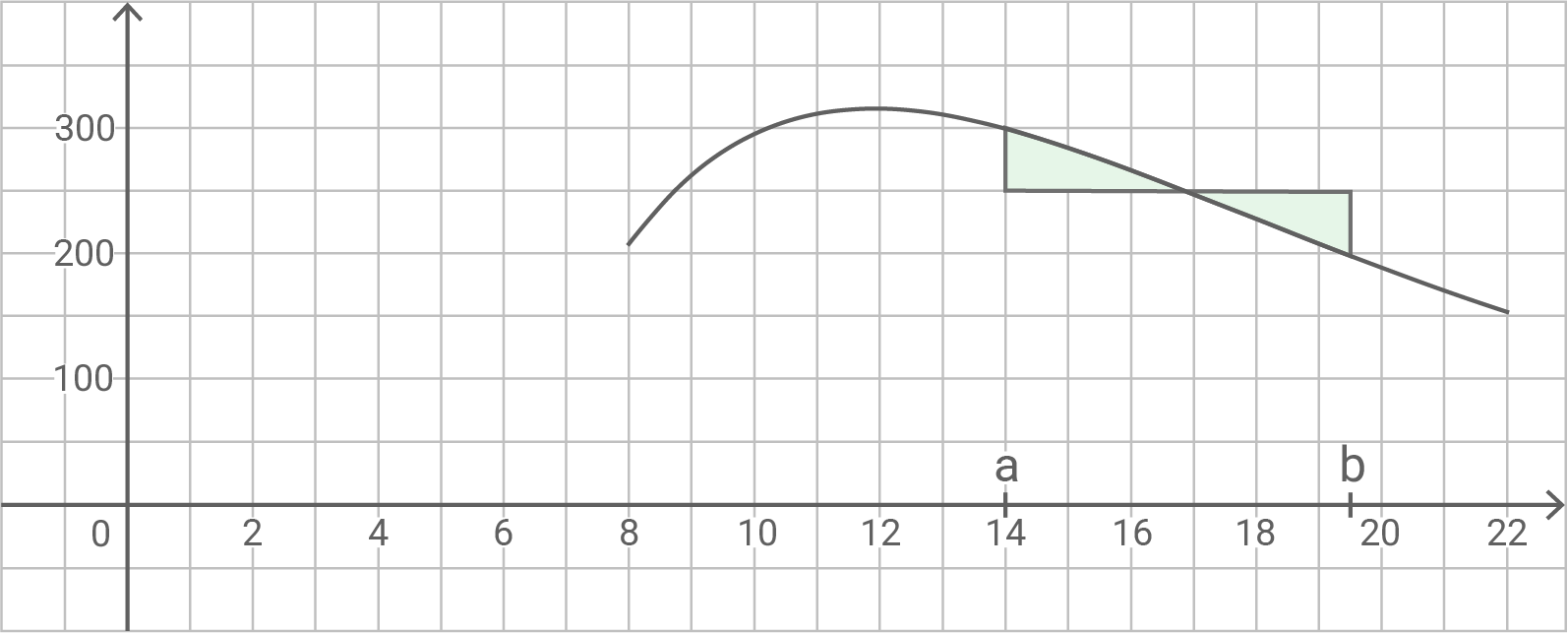
Mögliche Werte für und
bestimmen
Durch geeignete Eintragungen folgt für die Werte und
Vorgehen beschreiben
Als erstes wird der Ausschnitt der Gerade eingezeichnet. Dann werden auf der
-Achse die Stellen
und
markiert, sodass die Fläche zwischen dem Graphen von
der Gerade
sowie den Geraden mit den Gleichungen
und
aus zwei Flächenstücken gleichen Inhalts besteht.